Das A und O bei der Rehetherapie ist die zukünftige Fütterung beim Pferd mit Hufrehe
Exzessive Energiefütterung über den normalen Verbrauch eines Pferdes hinaus wird unvermeidlich zur Gewichtszunahme führen. Daher ist es von hoher Bedeutung, die benötigten Futtermengen auf Grundlage des Pferdegewichts und der täglichen Arbeit zu kennen. Fettleibigkeit von Pferden erhöht nicht nur das Risiko an Hufrehe zu erkranken, sondern sie belastet das Herz, die Lunge und die Gelenke. Junge, heranwachsende adipöse Pferde leiden nach wissenschaftlichen Erkenntnissen weit häufiger an degenerativen Gelenkerkrankungen. Neben der gesundheitlichen Probleme sind die Überversorgung und die damit verbundene Fettleibigkeit oder die Zuckervergiftung auf Grund der Aufnahme von zu viel oder gefährlicher leicht verdaulicher Kohlenhydrate die häufigsten Gründe für die Erkrankung.
Abspecken – mit Maß ist das Ziel der Fütterung beim Pferd mit Hufrehe
Lassen Sie sich für Ihr Pferd eine individuelle Kraftfutter- und Heuration, die zu einer langsamen aber stetigen Gewichtsreduktion führt, berechnen. Hier sollten Sie sich an spezielle Ernährungsberater wenden (z.B. Natural Horse Care) und die Mengen möglichst genau ausrechnen lassen. Wichtig dabei ist, dass die „Abnehmkur“ langsam durchgeführt wird. Nicht nur weil das Pferd keinen Hunger leiden soll (Tierschutzrelevant), sondern weil sie ansonsten die Gefahr der Entstehung einer metabolischen Entgleisung (Hyperlipidämie) riskieren.
Bei dieser oft tödlich endenden Erkrankung kommt es beim Abbau von Depotfetten zur Freisetzung von Lipiden. Diese wiederum führen zu einer gefährlichen Verfettung der zentralen Organe. Vermeiden Sie stark Getreide-, Stärke- oder Zuckerhaltige Mischfutter bei der Fütterung beim Pferd mit Hufrehe. Verabreichen Sie, wenn nötig Misch- bzw. Kraftfutter in kleinen Portionen über den Tag verteilt.
Fütterung Pferd Hufrehe: Weidegang mit Maß und Ziel
Während der Weidesaison liegt die Hauptvielfalt der Nahrung im Gras selbst. Für viele ist es kaum vorstellbar, wie hoch der Gehalt an Kohlenhydraten einer Weide sein kann. Gras tendiert dazu, durch hohe Photosyntheseaktivität übermäßig produzierten Zucker in Form von Fruktan anzureichern. Gerade deshalb sollte insbesondere in den kritischen Monaten oder bei kritischen Temperaturen (siehe dazu Artikel "Hufrehe – Risikofaktor Weidegras in der kalten Jahreszeit!"). Lassen Sie Ihr Pferd nur mit Maulkorb auf die Weide oder stark zeitlich begrenzt. In vielen Fällen hat es sich bewährt solchen Pferden einen sogenannten täglichen „Diätpaddock“ zur Verfügung zu stellen.
Ein Pony kann bis zu 15 kg Gras am Tag aufnehmen. Bereits 5 kg reichen aus, um in einer kritischen Jahreszeit mit hohem Fruktangehalt im Gras eine Hufrehe auszulösen - das wäre nach 4 – 6 Std. Weidezeit. Daher sollten reheanfällige Pferde lediglich in 15 – 30 Minuten Intervallen (schrittweise erhöht) auf die Pferdeweide dürfen und das auch nur dann, wenn die Wachstumsphase der Gräser weitestgehend beendet ist. Achten Sie darauf, dass während der Anweidung andere Futtermittel deutlich reduziert werden.
Zunehmen mit Maß und Ziel
Bei untergewichtigen Tieren sollte versucht werden mit leicht erhöhten Mengen an Kraftfutter und Grundfutter das Körpergewicht zu erhöhen. In diesen Fällen wäre es kontraindiziert eine weitere Kalorienreduktion vorzunehmen. Auch hier sollte ein entsprechend errechneter Futterplan durch einen professionellen Ernährungsberater die genauen Mengen empfehlen. Eine ernährungsbedingte Hufrehe bei untergewichtigen Pferden ist eher selten. Meist lag hier eher eine Allgemeinerkrankung vor (chronische Leber- und/der Nierenerkrankung, EMS). Bei der Verabreichung des Futters sollte aber darauf geachtet werden, dass die Mengen nicht schädigend auf die Dickdarmflora einwirken.
Essentielle Nähr- und Wirkstoffe sowie Mengen und Spurenelemente sind bei der Fütterung beim Pferd mit Hufrehe wichtiger denn je!
Grundsätzlich ist es von Nöten, gerade Pferde mit Hufrehe mit allen wichtigen Nährstoffen sowie Mengen und Spurenelementen zu versorgen, die für den Aufbau und die Reparatur von Gewebe benötigt werden. Die Hauptaufgabe eines bei akuter Hufrehe zu verabreichenden Ergänzungsfutters sollte in der Förderung einer gesunden mikrobiellen Besiedlung des Darmes liegen. Das Verhindern des Wachstums krankmachenden Keime, die Neutralisation von Giftstoffen sowie eine Stabilisierung des zu niedrigen PH-Wertes im Darm hat sich im akuten Stadium als sehr wichtig erwiesen.
 >> Fütterung Pferd Hufrehe: Rehe akut kann helfen! <<
>> Fütterung Pferd Hufrehe: Rehe akut kann helfen! <<
Mit der täglichen Verabreichung der Zusatz- und Inhaltsstoffe des neu entwickelten Produktes Rehe akut wird dies ernährungsphysiologisch unterstützt. Zusätzlich erfolgt eine wirkungsvolle Aktivierung der natürlichen körpereigenen Abwehrkräfte durch die Stimulation des Immunsystems im Darm durch probiotischen Aktivhefezellen.
Hufrehepferde haben meist eine eingeschränkte Darmfunktion. Daher gilt es in besonderem Maße, diese durch gezielte Fütterung mit hochwertigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen diese zu versorgen. Darüber hinaus schützen Vitamine, z.B. Vitamin A, C und E als Antioxidantien besonders die Leber des Pferdes vor den Auswirkungen aggressiver Schadsubstanzen und stärken das Immunsystem.
Die Leber als Entgiftungsorgan ist in den meisten Fällen ebenfalls deutliche mehr belastet als normal und benötigt daher einen höheren Gehalt an Nährstoffen die helfen, die entstandenen Toxine zu deaktivieren und zu eliminieren. Kräuter wie Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn und Süßholz bewirken durch ihre regenerativen Wirkstoffe eine gezielte Harmonisierung der Leberfunktion. Betain unterstützt in der Leber die rasche Verarbeitung und Ausscheidung von belastenden StoffwechSelendprodukten, insbesondere des Laktats. Mit der Zuführung von B-Vitaminen und Folsäure wird die Niere bei der schnellen Ausscheidung von Fremdsubstanzen aus dem Blut unterstützt.
Mit der Entwicklung dieses speziellen bei der Fütterung beim Pferd mit Hufrehe einzusetzenden Produkts hat Natural Horse Care nachhaltig darauf geachtet, dass keine genetisch veränderten Inhaltstoffe beigemischt werden. Denn gerade bei Pferden mit Hufrehe, EMS oder Cushing ist der Einfluss von genetisch veränderten Futtermitteln auf den Krankheitsverlauf der Pferde noch nicht erforscht.
Im Anschluss einer 4- bis 6-wöchigen Kur mit Rehe akut empfehlen wir für weitere 2 bis 4 Monate entweder MeboSyn zuzufüttern, welches auch bei Pferden mit EMS oder PSSM sehr gut geeignet ist, oder hochdosiert unser Mineral Plus um eine hochwertige Mineral- und Vitalstoffversorgung sicherzustellen.
 >> MeboSyn - hochwertige Nahrungsergänzung nach einer Hufrehe <<
>> MeboSyn - hochwertige Nahrungsergänzung nach einer Hufrehe <<
Hier bestellen: >>Rehe akut<<
 Knorpelschädigung und die veränderte Biomechanik des betroffenen Gelenks verursachen über eine Entzündung des Gelenks Schmerzen, die Ihr Tier Ihnen durch Bewegungsunlust, anhaltende oder zeitweise Lahmheit offenbart.
Knorpelschädigung und die veränderte Biomechanik des betroffenen Gelenks verursachen über eine Entzündung des Gelenks Schmerzen, die Ihr Tier Ihnen durch Bewegungsunlust, anhaltende oder zeitweise Lahmheit offenbart. Arthrotisch veränderte Gelenke sind nicht nur meist schmerzhaft, sie sind auch häufig durch Knochenzubildungen oder reaktiv vermehrte Gelenks- füllung (Gelenkserguss) verdickt.
Arthrotisch veränderte Gelenke sind nicht nur meist schmerzhaft, sie sind auch häufig durch Knochenzubildungen oder reaktiv vermehrte Gelenks- füllung (Gelenkserguss) verdickt.  >> Kotwasser beim Pferd: Waterstop kann helfen! <<
>> Kotwasser beim Pferd: Waterstop kann helfen! << Ingwer bietet in seiner Heilwirkung enorme Chancen, insbesondere dann, wenn es um einen langfristigen Erfolg geht.
Ingwer bietet in seiner Heilwirkung enorme Chancen, insbesondere dann, wenn es um einen langfristigen Erfolg geht. Eine Diagnose, die noch lange nicht das Aus für ein Pferd bedeuten muß: Spat beim Pferd gehört mit zu den häufigsten Knochenerkrankungen. Es handelt sich um eine chronische Knochenarthritis im Bereich des Sprunggelenks von der alle Pferde in jeder Altersstufe betroffen sein können. Häufig finden sich Traber oder Dressurpferde unter den Patienten. Es beginnt mit einer schmerzbedingten Lahmheit, die sich verstärkt, sobald das Tier vom Schritt zum Trab übergeht. Bei noch nicht allzu weit verknöchertem Gelenk ist die Lahmheit oft nur in den ersten Minuten zu erkennen und verschwindet bei weiterer Bewegung wieder scheinbar.In Abhängigkeit von der betroffenen Stelle zeigt das Pferd eine leichte Steifheit bis hin zur Lahmheit.
Eine Diagnose, die noch lange nicht das Aus für ein Pferd bedeuten muß: Spat beim Pferd gehört mit zu den häufigsten Knochenerkrankungen. Es handelt sich um eine chronische Knochenarthritis im Bereich des Sprunggelenks von der alle Pferde in jeder Altersstufe betroffen sein können. Häufig finden sich Traber oder Dressurpferde unter den Patienten. Es beginnt mit einer schmerzbedingten Lahmheit, die sich verstärkt, sobald das Tier vom Schritt zum Trab übergeht. Bei noch nicht allzu weit verknöchertem Gelenk ist die Lahmheit oft nur in den ersten Minuten zu erkennen und verschwindet bei weiterer Bewegung wieder scheinbar.In Abhängigkeit von der betroffenen Stelle zeigt das Pferd eine leichte Steifheit bis hin zur Lahmheit. >> ArthriAid - unterstützen Sie den Gelenkstoffwechsel Ihres Pferdes! <<
>> ArthriAid - unterstützen Sie den Gelenkstoffwechsel Ihres Pferdes! << Der Fellwechsel bei Pferden wird mit dem Abwurf des alten und spröde gewordenen oft farblosen Winterfells eingeläutet. Ab diesem Moment beginnt für den Pferdeorganismus die Schwerstarbeit. In relativ kurzer Zeit muss neues hochwertiges Deckhaar gebildet werden.
Der Fellwechsel bei Pferden wird mit dem Abwurf des alten und spröde gewordenen oft farblosen Winterfells eingeläutet. Ab diesem Moment beginnt für den Pferdeorganismus die Schwerstarbeit. In relativ kurzer Zeit muss neues hochwertiges Deckhaar gebildet werden.

 Futter ist die Grundlage der Tierhaltung - das gilt für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung, die nach gelagerte Ernährungsindustrie und die Haltung von Heim- und Hobbytieren. In Deutschland geben landwirtschaftliche und private Tierhalter jährlich etwa 10,5 Mrd. € für Futtermittel aus. Allein die Pferdehalter verfütterten nach einer Erhebung des DTV e.V. in Deutschland im Jahr 2008 ca. 2,11 Millionen Tonnen Kraft- und Mischfutter.
Futter ist die Grundlage der Tierhaltung - das gilt für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung, die nach gelagerte Ernährungsindustrie und die Haltung von Heim- und Hobbytieren. In Deutschland geben landwirtschaftliche und private Tierhalter jährlich etwa 10,5 Mrd. € für Futtermittel aus. Allein die Pferdehalter verfütterten nach einer Erhebung des DTV e.V. in Deutschland im Jahr 2008 ca. 2,11 Millionen Tonnen Kraft- und Mischfutter.
 Das vielseitige Angebot an industriellen Ernährungskonzepten unterschiedlicher Hersteller und deren Zusatzfutter für Pferde hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Darüber hinaus stehen viele Pferde auf Hochleistungsgräsern (Deutsches Weidelgras, Rohrschwingel oder Wiesenschwingel), welche gezielt auf Schmackhaftigkeit gezüchtet wurden und appetit- oder/ und geschmacksanregende Substanzen enthalten. Leistungsgräser werden unter anderem auf die Erhöhung von Konkurrenzkraft, Winterhärte und Resistenzen gegen Stress (Frost, Trockenheit, Parasiten) hin gezüchtet.
Das vielseitige Angebot an industriellen Ernährungskonzepten unterschiedlicher Hersteller und deren Zusatzfutter für Pferde hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Darüber hinaus stehen viele Pferde auf Hochleistungsgräsern (Deutsches Weidelgras, Rohrschwingel oder Wiesenschwingel), welche gezielt auf Schmackhaftigkeit gezüchtet wurden und appetit- oder/ und geschmacksanregende Substanzen enthalten. Leistungsgräser werden unter anderem auf die Erhöhung von Konkurrenzkraft, Winterhärte und Resistenzen gegen Stress (Frost, Trockenheit, Parasiten) hin gezüchtet. >> Mineral Plus - Zusatzfutter für Pferde mit organisch gebundenen Mineral- und Vitalstoffen <<
>> Mineral Plus - Zusatzfutter für Pferde mit organisch gebundenen Mineral- und Vitalstoffen <<

 Der Herbst ist da und mit ihm wechselhaftes, nasskaltes Wetter! Ein gesunder Stoffwechsel Ihres Pferdes ist nun gefragt! Winterfell muß entwickelt werden. Die Sonne scheint kürzer und seltener. Das Gras stellt sein Höhenwachstum ein und bildet gerade in Frostnächten Fruktane. Der Anteil des im Gras enthaltenen Eiweiß steigt, der Anteil der Rohfaser nimmt ab.
Der Herbst ist da und mit ihm wechselhaftes, nasskaltes Wetter! Ein gesunder Stoffwechsel Ihres Pferdes ist nun gefragt! Winterfell muß entwickelt werden. Die Sonne scheint kürzer und seltener. Das Gras stellt sein Höhenwachstum ein und bildet gerade in Frostnächten Fruktane. Der Anteil des im Gras enthaltenen Eiweiß steigt, der Anteil der Rohfaser nimmt ab.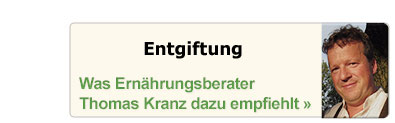


 >> EasoFlex - Ingwer, Yucca, MSM und Teufelskralle für die Gelenke<<
>> EasoFlex - Ingwer, Yucca, MSM und Teufelskralle für die Gelenke<< Schimmelpilze im Weidegras, Heu, Silage sowie im Mischfutter sind keine Seltenheit. Schimmelpilze bilden zu ihrem eigenen Schutz sogenannte Mykotoxine (=Stoffwechsel-produkte von Schimmelpilzen). Mykotoxine gehören zu den giftigsten Stoffen, die die Natur zu bieten hat.
Schimmelpilze im Weidegras, Heu, Silage sowie im Mischfutter sind keine Seltenheit. Schimmelpilze bilden zu ihrem eigenen Schutz sogenannte Mykotoxine (=Stoffwechsel-produkte von Schimmelpilzen). Mykotoxine gehören zu den giftigsten Stoffen, die die Natur zu bieten hat.
 N-Sulin bestellen >> hier <<
N-Sulin bestellen >> hier <<
 >> GladiatorPLUS hier bestellen <<
>> GladiatorPLUS hier bestellen <<
 KPU (Kryptopyrrolurie) ist eine Stoffwechselkrankheit, die zunächst beim Menschen entdeckt wurde. Früher wurde sie auch gerne als Malvaria oder Mauve Krankheit bezeichnet. Heute rückt man mittlerweile von der Bezeichnung KPU ab und nennt diese Erkrankung HPU (Hämopyrrolaktamurie). Da die Stoffwechselerkrankung KPU zunehmend in einer Familie und dann überwiegend bei Frauen diagnostiziert wurde, geht man heute von einer vererbbaren Krankheit bei Menschen aus. In der Medizin aber sieht man einen Unterschied zwischen KPU beim Menschen und KPU beim Pferd. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass aktiviertes Vitamin B6 (P5P) Zink und Mangan verloren gehen. Gerade aber das P5P spielt vor allem im Entgiftungsstoffwechsel der Leber und der Verarbeitung von Eiweißen und Aminosäuren beim Pferd eine entscheidende Rolle. Damit aber das Vitamin B6 als P5P aktiviert werden kann, benötigt es ausreichend Zink und Vitamin B2.
KPU (Kryptopyrrolurie) ist eine Stoffwechselkrankheit, die zunächst beim Menschen entdeckt wurde. Früher wurde sie auch gerne als Malvaria oder Mauve Krankheit bezeichnet. Heute rückt man mittlerweile von der Bezeichnung KPU ab und nennt diese Erkrankung HPU (Hämopyrrolaktamurie). Da die Stoffwechselerkrankung KPU zunehmend in einer Familie und dann überwiegend bei Frauen diagnostiziert wurde, geht man heute von einer vererbbaren Krankheit bei Menschen aus. In der Medizin aber sieht man einen Unterschied zwischen KPU beim Menschen und KPU beim Pferd. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass aktiviertes Vitamin B6 (P5P) Zink und Mangan verloren gehen. Gerade aber das P5P spielt vor allem im Entgiftungsstoffwechsel der Leber und der Verarbeitung von Eiweißen und Aminosäuren beim Pferd eine entscheidende Rolle. Damit aber das Vitamin B6 als P5P aktiviert werden kann, benötigt es ausreichend Zink und Vitamin B2.