![Klinische Studie bestätigt Wirksamkeit von GastroCare]() In der Studie wurden die von Kunden zu untersuchenden Pferde mit Verdacht auf Magengeschwür in der Klinik aufgenommen und gastroskopiert. Ergab die Gastroskopie einen Ulzerationsindex von 2 oder höher wurden die Pferde in die Studie mit aufgenommen, sofern 28 Tage vor Beginn der Studie keinerlei Medikation gegen Geschwüre verabreicht wurde.
In der Studie wurden die von Kunden zu untersuchenden Pferde mit Verdacht auf Magengeschwür in der Klinik aufgenommen und gastroskopiert. Ergab die Gastroskopie einen Ulzerationsindex von 2 oder höher wurden die Pferde in die Studie mit aufgenommen, sofern 28 Tage vor Beginn der Studie keinerlei Medikation gegen Geschwüre verabreicht wurde.
Alle zu untersuchenden Pferde befanden sich im Besitz von Amateurreitern und abgesehen von der Zufütterung von NutriScience GastroCare wurde keine Veränderung ihrer Tagesroutine oder Ernährung vorgenommen. In der Studie wurden den Pferden keine zusätzlichen Medikamente gegen Magenulzera verabreicht.
Viele Studien an Sport und Freizeitpferden scheinen zu bestätigen, was in vielen Publikationen über die Zahl der an Magengeschwüren leidenden Pferde berichtet wird. Über 90 % der Pferde im Rennsport leiden danach vermehrt an Magengeschwüren. Die Zahl dürfte aber in der Realität nicht ganz so hoch sein, da i.d.R. bereits Pferde mit Symptomen in solche Studien mit aufgenommen wurden. Dennoch wird aus den Studien deutlich, dass es sich hier um ein zunehmend vorhandenes Problem handelt.
Auch an fast 50 % der bei Studien untersuchten 700 Jungpferde und Fohlen, zieht man die drei größten Studien Murray und Wilson heran, konnten Magengeschwüre bzw. krankhafte Veränderungen an der Magenschleimhaut festgestellt werden. Ursache sind eine zu frühe Verabreichung von sogenannten Fohlenstartern (konzentrierte auf Fohlen ausgerichtete Kraftfuttermischungen) und/oder spezielle, oft überdosierte, pelletierte Mineral- und Energiefutter.
Auch war man sich bei den Jungpferden einig, dass das Unterbringen in Aufzuchtgruppen oder das zu frühe Absetzen für junge Pferde Streß bedeuten kann. Streß wiederum setzt sowohl bei Jungpferden als auch bei erwachsenen Pferden eine unangenehme Spirale in Gang, an dessen Ende Magengeschwüre stehen können.
Zusammenfassend lässt sich aber zweifelsfrei feststellen, dass meist Fütterungsfehler und/oder Streß Auslöser sind. Stress hat immensen Einfluss auf das vegetative Nervensystem das unter anderem die Produktion von Salzsäure steuert. So stellte man z.B. bei im Herdenverband gehaltenen Pferden insbesondere im Winter einen massiven Anstieg von Magengeschwüren fest. Als Ursache hierfür sieht Frau Dr. Blessing, der Pferdeklinik München Parsdorf Herdendruck und die „Rangkämpfe“, die entstehen, weil die Pferde im Winter meist beengter gehalten werden.
Somit ist das Magengeschwür nicht nur ein Problem der Sportpferde, sondern auch ein Problem, dass sich durch alle Reitsportarten und Haltungsformen zieht.
![GastroCare - jetzt vorbeugen und bestellen! GastroCare - jetzt vorbeugen und bestellen!]() >> GastroCare - jetzt vorbeugen und bestellen! <<
>> GastroCare - jetzt vorbeugen und bestellen! <<
![Magenschleimhautreizung Pferd Magenschleimhautreizung Pferd]() Bei allen Untersuchungen konnten aber keine Bakterien ausfindig gemacht werden, die wie beim Menschen oder Schwein für derartige Magenprobleme verantwortlich sind. Die Bakterien Heliobacter pylori wurden beim Pferd nie nachgewiesen. Daher kann man durch die veröffentlichten Untersuchungen an mehreren tausend jungen und erwachsenen Pferden in erster Linie als Ursache eine Kombination aus Stress und pferdeuntypischer Fütterung in Betracht ziehen.
Bei allen Untersuchungen konnten aber keine Bakterien ausfindig gemacht werden, die wie beim Menschen oder Schwein für derartige Magenprobleme verantwortlich sind. Die Bakterien Heliobacter pylori wurden beim Pferd nie nachgewiesen. Daher kann man durch die veröffentlichten Untersuchungen an mehreren tausend jungen und erwachsenen Pferden in erster Linie als Ursache eine Kombination aus Stress und pferdeuntypischer Fütterung in Betracht ziehen.
Aber auch Medikation oder starker Wurmbefall können Ursache für die Entstehung von Magengeschwüren sein. Die Magendassel z.B. bohrt regelrechte Löcher in die Magenwand und bietet somit eine ideale Angriffsfläche für die Magensäure. Ebenso diskutiert werden schmerz- und entzündungsmindernde steroidale Medikamente oder Kräuter wie Teufelskralle oder Ingwer.
Nur bei einer kontinuierlichen Futteraufnahme kommt es zu einer ausgewogenen Pufferung der im Pferdemagen produzierten Säure. Nimmt ein Pferd also länger kein Futter auf, wird das Gleichgewicht im Magen gestört. Pferde produzieren den zur Pufferung notwendigen Speichel i.d.R. nur bei der Nahrungsaufnahme. Da aber Pferde Kraftfutter wesentlich schneller fressen und dabei weniger Speichel produzieren kommt es zwangsläufig zu einer höheren Säurebelastung im Pferdemagen. Ebenso wurde beobachtet, dass jede Art von Kraftfutter die Produktion des Peptidhormons Gastrin verstärkt. Gastrin stimuliert die Salzsäuresekretion. Diese salzhaltige Magensäure, mit deren Hilfe die Eiweiße zerlegt werden greifen die Magenwände an.
Im Idealfall wir diese von einer schützenden Schleimschicht überzogen. Gerät dieses Gleichgewicht aus den Fugen, wird die Magenwand regelrecht verätzt und es kann zu kraterartigen Vertiefungen und Löchern in der Magenwand kommen. Die Folgen sind schlimmstenfalls Magenblutungen, die auch zu einem tödlichen Magendurchbruch führen können.
In den meisten Fällen aber sind die Anzeichen bereits lange vorher schon deutlich erkennbar. Viele Pferde zeigen bereits schon früh eine geringere Leistungsfähigkeit und häufige kleinere Koliken. Diese Beobachtung machten auch die Pferdebesitzer der erst jüngst von NutriScience Irland in Deutschland in Auftrag gegebenen Studie zur Wirksamkeit von GastroCare. Bei allen Pferden wurde eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit beschrieben. Aber auch Freßstörungen, Durchfall, Kotwasser, Gewichtsverlust, Zähneknirschen, Speicheln und Gähnen oder häufiges Liegen sind Symptome, die bei Pferden mit Magengeschwüren beobachtet wurden. Wobei die Symptome nicht immer überall gleich oder zusammen auftreten.
![Magenschleimhautreizung Pferd Magenschleimhautreizung Pferd]() Die sicherste Methode zur Diagnose von Magengeschwüren ist die Magenspiegelung mittels Endoskop. Im Regelfall wird diese stationär in einer Klinik ausgeführt und kostet zwischen 200 und 350 Euro.
Die sicherste Methode zur Diagnose von Magengeschwüren ist die Magenspiegelung mittels Endoskop. Im Regelfall wird diese stationär in einer Klinik ausgeführt und kostet zwischen 200 und 350 Euro.
Fütterung als Lösung zur Behandlung von Magengeschwüren
Ein praktischer Ansatz für die langfristige Prophylaxe und Behandlung von Magenschleimhautentzündungen und Magengeschwüren ist der Einsatz eines Kombinationsproduktes, das den Säuregehalt des Magens reduziert (durch Erhöhung des pH-Wertes), lokal die Heilung des Geschwürs fördert und die tägliche Ballaststoffaufnahme erhöht.
NutriScience hat das Produkt GastroCare entwickelt, um leichte bis mittlere Magenulzera zu behandeln. GastroCare wird zum einen als Säurepuffer eingesetzt. Zum anderen unterstützt das Glutamin und Lecithin die lokale Heilung und Regeneration der Magenschleimhaut. Zum Schutz der Schleimhaut verwendet NutriScience u.a. Pektin und Lecithin als lösliche Ballaststoffe. Diese nachfolgende Studie der Pferdeklinik München Parsdorf durch Frau Dr. Susanne Blessing, bewertete GastroCare als einziges Ergänzungsfutter für die Behandlung von Magenulzera bei Pferden.
Studienverlauf
In der Studie wurden die von Kunden zu untersuchenden Pferde mit Verdacht auf Magengeschwür in der Klinik aufgenommen und gastroskopiert. Ergab die Gastroskopie einen Ulzerationsindex von 2 oder höher wurden die Pferde in die Studie mit aufgenommen, sofern 28 Tage vor Beginn der Studie keinerlei Medikation gegen Geschwüre verabreicht wurde.
Alle zu untersuchenden Pferde befanden sich im Besitz von Amateurreitern und abgesehen von der Zufütterung von GastroCare wurde keine Veränderung ihrer Tagesroutine oder Ernährung vorgenommen.
In der Studie wurden den Pferden keine zusätzlichen Medikamente gegen Magenulzera verabreicht.
Tag 0: Untersuchung und Endoskopie gefolgt von 30 Tagen Behandlung mit GastroCare
Tag 30: Untersuchung und Endoskopie
Endoskopieverfahren:
8 bis 12 Stunden vor der endoskopischen Untersuchung wurde nicht gefüttert und 2 bis 4 Stunden vor der Endoskopie wurde nicht getränkt. Die Pferde wurden mit Rompun intravenös sediert. Häufig wurde eine Nasenbremse aufgesetzt, bevor das Video-Gastro-Endoskop über die Nüstern in den Magen eingeführt wurde. Der Magen wurde systematisch abgesucht. Jedes Pferd wurde vom Tierarzt auf einer Skala von 0 bis 5 bewertet. Der gleiche Tierarzt führte die Endoskopie auch am 30. Tag aus.
Für jedes Pferd wurde ein Auswertungsblatt zu Beginn der ersten und bei der zweiten endoskopischen Untersuchung ausgefüllt, sowie eine kurze Zusammenfassung der klinischen Änderungen wurde schriftlich im Datenblatt festgehalten. Untersucht wurde bei dieser Studie, ob bei der regelmäßigen, 30 tägigen Zugabe von GastroCare Veränderungen im Schweregrad der krankhaften Veränderung der Magenschleimhaut festzustellen waren.
Wie wirkt GastroCare?
Die im GastroCare enthaltenen Antiacida (Säurepuffer) initiieren die Heilung bei Magenulzera durch das Abpuffern überschüssiger Magensäure und den Schutz der Magenschleimhaut. Es wird auch vermutet, (Lambrecht, 1993) dass einige Antiacida durch die Anregung der lokalen Prostaglandinproduktion die Magenschleimhaut schützen, indem die Durchblutung der Region gefördert wird. Antiacida ahmen die Wirkung von Speichel nach, in dem sie einen Teil der Magensäure abpuffern. Das unterstützt den Schutz des oberen Teils des Magens, der über keine Schutzschicht verfügt.
Jede Verabreichung von GastroCare bietet in etwa 6 Stunden Schutz. Der Pektin-Lecithin-Ballaststoff-Komplex im GastroCare hilft die schädlichen Auswirkungen des Rückflusses von Gallensäure durch eine Stabilisierung der Schleimhaut und durch die Erhöhung der Puffer-Kapazität des Mageninhaltes zu verhindern. Lecithin wiederum bildet nach ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen eine stark hydrophobe Schicht und stärkt dadurch die säureabstoßende Schutzschicht der Schleimhautzellen. Der lösliche Lecithin-Pektin-Ballaststoff-Komplex in GastroCare absorbiert einen Teil der überschüssigen Säure und hält so weitere Säure von der Magenwand ab.
Das Glutamin in GastroCare bietet schließlich die essentielle Energiequelle für eine schnellere Regeneration der Magenschleimhaut. Glutamin ist eine Aminosäure und die hauptsächliche Energiequelle für die Enterozyten (Zellen, die die Innenseite des Dünndarms auskleiden).
Die Studie hat die Wirksamkeit einer Kombination aus Säureblocker, Glutamin und löslichen Ballaststoffen (enthalten im Nahrungsergänzungsfuttermittel GastroCare), zur Behandlung leichter bis mittlerer Magenulzera bei Pferden untersucht. Bei allen Pferden, bei denen man durch eine endoskopische Untersuchung Magengeschwüre verschiedener Schweregrade fand, wurde die Futterergänzung GastroCare über einen Zeitraum von 30 Tagen verabreicht. Danach wurden sie einer weiteren Endoskopie unterzogen. Die Ergebnisse zeigten, dass 85 % der Pferde nach 30 Tagen eine beträchtliche Verbesserung der Ulzeration mit einer Reduzierung bzw. dem Verschwinden der gezeigten Symptome aufwiesen.
Diese Studie bestätigte die ursprünglichen Befunde einer Studie von 2005, die zu dem Ergebnis kam, dass die Nahrungsergänzung GastroCare bei Magengeschwüren sowohl für die Prophylaxe als auch für ihre Behandlung bei Pferden sehr gut einsetzbar ist.
Warum GastroCare von NutriScience?
Aufgrund seiner Zusammensetzung kann das untersuchte Ergänzungsfuttermittel gefahrlos auch bis zum Tag eines Wettkampfes verabreicht werden. Gegenüber einer medizinischen Standardbehandlung für Magenulzera bei Fohlen und Pferden mit großflächiger Ulzeration ist u.a. Omeprazol, ein pharmazeutisches Produkt, das die Produktion von Säure im Magen hemmt, selbst wenn die Pferde aktiv weiter trainiert werden. Der Preis für diese und ähnlich wirkende Substanzen ist sehr hoch.
Der hohe Preis führt dazu, dass das Medikament oft nur in sehr starken Fällen eingesetzt wird und die Behandlung i.d.R. zu früh abgebrochen wird. Dies kann sich für dessen Einsatz als beschränkender Faktor erweisen, wie auch die Tatsache, dass es einen Rückfall rezidiv nicht verhindern kann. Bedauerlicherweise trifft man diese Beobachtung bei Ulzera sehr häufig an. Der Einsatz dieser oder ähnlicher Substanzen unterliegen zudem für die meisten Wettbewerbe strengen Auflagen.
Ein praktischerer Ansatz für die langfristige Prophylaxe und Behandlung ist der Einsatz eines Kombinationsproduktes, das den Säuregehalt des Magens reduziert (durch Erhöhung des pH-Wertes), lokal die Heilung des Geschwürs fördert und die tägliche Ballaststoffaufnahme erhöht. NutriScience hat hierfür das Produkt GastroCare entwickelt, um leichte bis mittlere Magenulzera zu behandeln.
GastroCare wird zum einen als Säurepuffer eingesetzt. Zum anderen unterstützt das Glutamin und Lecithin die lokale Heilung und Regeneration der Magenschleimhaut. Zum Schutz der Schleimhaut verwendet NutriScience u.a. Pektin und Lecithin als löslichen Ballaststoff.
![GastroCare - jetzt vorbeugen und bestellen! GastroCare - jetzt vorbeugen und bestellen!]() >> GastroCare - jetzt vorbeugen und bestellen! <<
>> GastroCare - jetzt vorbeugen und bestellen! <<
Mehr zum Thema:
 Das Thema Entwurmung, Endoparasiten, Wurmbefall bei Pferden und welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen beschäftigt schon immer die Pferdewelt. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.
Das Thema Entwurmung, Endoparasiten, Wurmbefall bei Pferden und welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen beschäftigt schon immer die Pferdewelt. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.

 „Mein Pferd fühlt sich wohl, es geht ihm gut, denn es kann 24 Stunden auf die Weide.“ oder „Mein Pferd bekommt jeden 2. Tag sein zubereitetes Mash und glänzt wie eine Speckschwarte“, sind oft Sätze, die man von Pferdebesitzern hört, wenn man sie über die Haltungs- und Futtergewohnheiten befragt.
„Mein Pferd fühlt sich wohl, es geht ihm gut, denn es kann 24 Stunden auf die Weide.“ oder „Mein Pferd bekommt jeden 2. Tag sein zubereitetes Mash und glänzt wie eine Speckschwarte“, sind oft Sätze, die man von Pferdebesitzern hört, wenn man sie über die Haltungs- und Futtergewohnheiten befragt.


 >> Hufrehe bei Pferden: Vorbeugen mit Yea Sacc Mikro <<
>> Hufrehe bei Pferden: Vorbeugen mit Yea Sacc Mikro <<

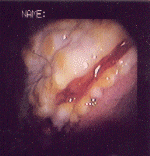 Bei allen Untersuchungen konnten aber keine Bakterien ausfindig gemacht werden, die wie beim Menschen oder Schwein für derartige Magenprobleme verantwortlich sind. Die Bakterien Heliobacter pylori wurden beim Pferd nie nachgewiesen. Daher kann man durch die veröffentlichten Untersuchungen an mehreren tausend jungen und erwachsenen Pferden in erster Linie als Ursache eine Kombination aus Stress und pferdeuntypischer Fütterung in Betracht ziehen.
Bei allen Untersuchungen konnten aber keine Bakterien ausfindig gemacht werden, die wie beim Menschen oder Schwein für derartige Magenprobleme verantwortlich sind. Die Bakterien Heliobacter pylori wurden beim Pferd nie nachgewiesen. Daher kann man durch die veröffentlichten Untersuchungen an mehreren tausend jungen und erwachsenen Pferden in erster Linie als Ursache eine Kombination aus Stress und pferdeuntypischer Fütterung in Betracht ziehen. Die sicherste Methode zur Diagnose von Magengeschwüren ist die Magenspiegelung mittels Endoskop. Im Regelfall wird diese stationär in einer Klinik ausgeführt und kostet zwischen 200 und 350 Euro.
Die sicherste Methode zur Diagnose von Magengeschwüren ist die Magenspiegelung mittels Endoskop. Im Regelfall wird diese stationär in einer Klinik ausgeführt und kostet zwischen 200 und 350 Euro.
 >> EquiPower Atemwegskräuter Liquid – 12 speziell aufeinander abgestimmte Heilpflanzen <<
>> EquiPower Atemwegskräuter Liquid – 12 speziell aufeinander abgestimmte Heilpflanzen << >> EQUIPUR-Bronchialkräuter: Stärken die Immunabwehr, schützen die Atemwege <<
>> EQUIPUR-Bronchialkräuter: Stärken die Immunabwehr, schützen die Atemwege <<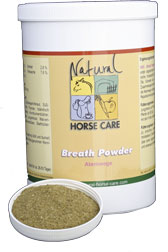


 Wie bei allen Wirbeltieren ist auch beim Pferd die Leber die größte Verdauungsdrüse des Körpers. Bei einem Pferd wiegt das aus zwei Hälften bestehende Organ ca. 5 kg. Die Leber des Pferdes setzt sich anatomisch aus den Leberlappen, aus den Leberbälkchen und den Hepatozyten (Leberzellen) zusammen. Die beiden Zugänge (Leberarterie und Pfortader) transportieren einerseits stark mit Sauerstoff angereichertes Blut vom Herzen kommend und andererseits Blut mit Nahrungsbestandteilen aus Magen und Darm, Abbauprodukten der Milz, sowie Hormonen der Bauchspeicheldrüse zur Leber.
Wie bei allen Wirbeltieren ist auch beim Pferd die Leber die größte Verdauungsdrüse des Körpers. Bei einem Pferd wiegt das aus zwei Hälften bestehende Organ ca. 5 kg. Die Leber des Pferdes setzt sich anatomisch aus den Leberlappen, aus den Leberbälkchen und den Hepatozyten (Leberzellen) zusammen. Die beiden Zugänge (Leberarterie und Pfortader) transportieren einerseits stark mit Sauerstoff angereichertes Blut vom Herzen kommend und andererseits Blut mit Nahrungsbestandteilen aus Magen und Darm, Abbauprodukten der Milz, sowie Hormonen der Bauchspeicheldrüse zur Leber.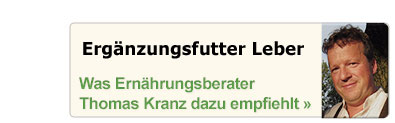
 Die Kolik beim Pferd zählt zu den häufigsten Störungen des Verdauungsapparates. Jährlich erkranken 10 von 100 Pferden an einer Kolik. Der Begriff Kolik beim Pferd ist keine Krankheitsbezeichnung sondern Ausdruck für einen Komplex an Symptomen die sich in Form von Bauchschmerzen zeigen. Die Ursachen für eine Kolik beim Pferd können sehr unterschiedlich sein. Entsprechend variieren die Anzeichen. Auch reagieren Pferde unterschiedlich auf Schmerzen.
Die Kolik beim Pferd zählt zu den häufigsten Störungen des Verdauungsapparates. Jährlich erkranken 10 von 100 Pferden an einer Kolik. Der Begriff Kolik beim Pferd ist keine Krankheitsbezeichnung sondern Ausdruck für einen Komplex an Symptomen die sich in Form von Bauchschmerzen zeigen. Die Ursachen für eine Kolik beim Pferd können sehr unterschiedlich sein. Entsprechend variieren die Anzeichen. Auch reagieren Pferde unterschiedlich auf Schmerzen. Untersuchungen haben ergeben, dass insbesondere das richtige Futtermanagement die Übersäuerung und damit die Entstehung von Magengeschwüren reduzieren kann. Auch bei Reisen sollte an ausreichend Raufutter im Hänger gedacht werden.
Untersuchungen haben ergeben, dass insbesondere das richtige Futtermanagement die Übersäuerung und damit die Entstehung von Magengeschwüren reduzieren kann. Auch bei Reisen sollte an ausreichend Raufutter im Hänger gedacht werden. Alle Stoffwechselvorgänge des Pferdes werden letztendlich durch die regelmäßige Aufnahme von Atemluft, Trinkwasser und Nahrung aufrechterhalten und wesentlich beeinflusst. Dadurch wird schnell deutlich, dass der Darm beim Pferd, bzw. der gesamte Verdauungstrakt die Wiege der Gesundheit darstellt.
Alle Stoffwechselvorgänge des Pferdes werden letztendlich durch die regelmäßige Aufnahme von Atemluft, Trinkwasser und Nahrung aufrechterhalten und wesentlich beeinflusst. Dadurch wird schnell deutlich, dass der Darm beim Pferd, bzw. der gesamte Verdauungstrakt die Wiege der Gesundheit darstellt. Mauke und Raspe – entzündliche Hauterkrankung in der Fesselbeuge
Mauke und Raspe – entzündliche Hauterkrankung in der Fesselbeuge >> Mauke: Pferde behandeln - Vitalstoffe zu Verfügung stellen! <<
>> Mauke: Pferde behandeln - Vitalstoffe zu Verfügung stellen! << >> Mauke beim Pferd behandeln: Schutz von aussen <<
>> Mauke beim Pferd behandeln: Schutz von aussen << >> Muddy & Skin PRO Powder: speziell um Mauke beim Pferd zu behandeln<<
>> Muddy & Skin PRO Powder: speziell um Mauke beim Pferd zu behandeln<< Kaltes, feuchtes Wetter, nasses Fell, kalte Zugluft, Wetterumschwünge: der Stoffwechsel arbeitet auf Hochtouren. Vermutlich ausgelöst durch die vermehrte Ausschüttung von Botenstoffen werden Entzündungsprozesse im Körper ankurbelt. Gelenke (Arthritis) und Muskeln entzünden sich. Die Pferde haben Schmerzen und sind in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt.
Kaltes, feuchtes Wetter, nasses Fell, kalte Zugluft, Wetterumschwünge: der Stoffwechsel arbeitet auf Hochtouren. Vermutlich ausgelöst durch die vermehrte Ausschüttung von Botenstoffen werden Entzündungsprozesse im Körper ankurbelt. Gelenke (Arthritis) und Muskeln entzünden sich. Die Pferde haben Schmerzen und sind in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt.
 Unsere Pferde haben wie wir Menschen und alle Säugetiere auch zwei Nieren. Anders als bei uns Menschen, ist eine Niere beim Pferd eher herzförmig und nur die linke Niere hat die bekannte „Bohnenform“. Die Nieren beim Pferd übernehmen eine führende Rolle in der Entgiftungsfunktion des Pferdes.
Unsere Pferde haben wie wir Menschen und alle Säugetiere auch zwei Nieren. Anders als bei uns Menschen, ist eine Niere beim Pferd eher herzförmig und nur die linke Niere hat die bekannte „Bohnenform“. Die Nieren beim Pferd übernehmen eine führende Rolle in der Entgiftungsfunktion des Pferdes. 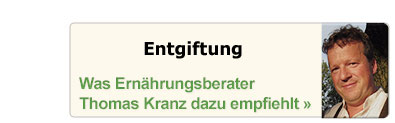
 Jeder Stallbetreiber und Pferdebesitzer kann es kaum noch erwarten. Endlich wird es Frühjahr und da Anweiden der Pferde kann beginnen. Dennoch ist gerade jetzt Vorsicht geboten. Durchfall, lebensgefährliche Koliken und Hufrehe sind die Folge, wenn zu schnell angeweidet wird. Heute weiß man, dass gerade für die Entstehung von Hufrehe nicht eine Eiweißüberversorgung sondern vor allem die Überfütterung mit Fruktanen und schwerverdaulichen Stärken (Getreide) als auslösende Faktoren angesehen werden.
Jeder Stallbetreiber und Pferdebesitzer kann es kaum noch erwarten. Endlich wird es Frühjahr und da Anweiden der Pferde kann beginnen. Dennoch ist gerade jetzt Vorsicht geboten. Durchfall, lebensgefährliche Koliken und Hufrehe sind die Folge, wenn zu schnell angeweidet wird. Heute weiß man, dass gerade für die Entstehung von Hufrehe nicht eine Eiweißüberversorgung sondern vor allem die Überfütterung mit Fruktanen und schwerverdaulichen Stärken (Getreide) als auslösende Faktoren angesehen werden.  >> MykoTox - der Toxinbinder - ideal auch während dem Anweiden der Pferde <<
>> MykoTox - der Toxinbinder - ideal auch während dem Anweiden der Pferde <<